Gefühle lassen sich nicht begraben – Wie mich das Schweigen krank machte
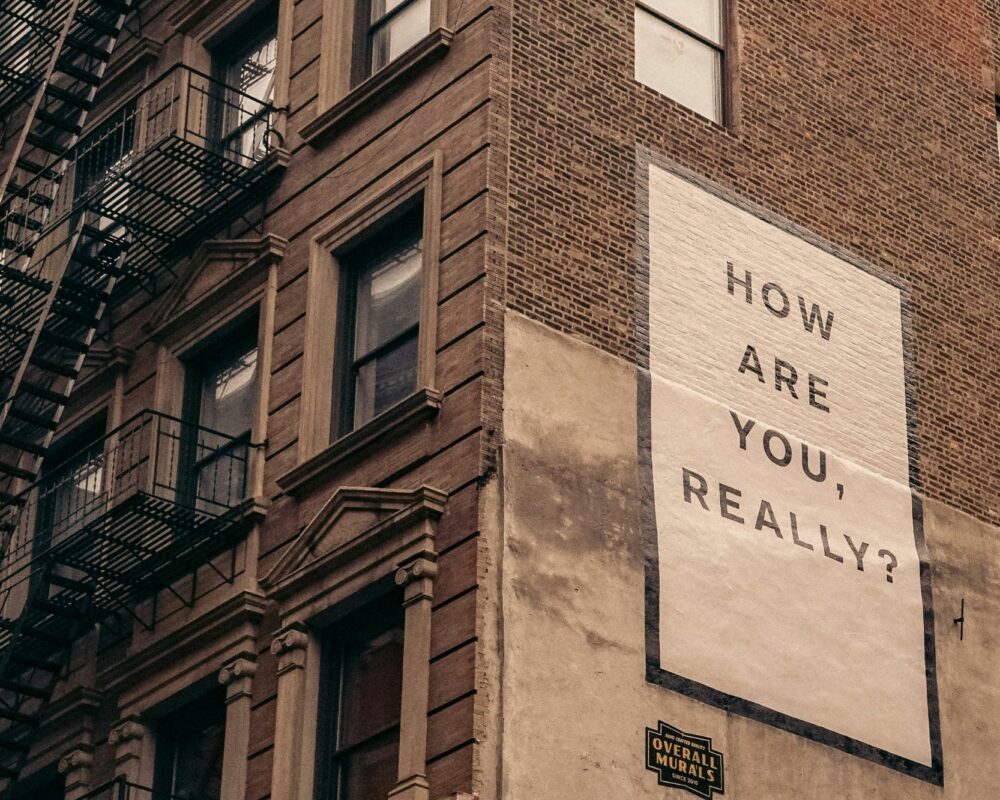
by Mitch via Unsplash
Tina Hoffmann ist selbstständige Texterin und bloggt vor allem über Berlin. In diesem Gastbeitrag schildert sie die Geschichte des Suizids ihres Vaters und wie das anschließende Schweigen sie später selbst psychisch erkranken ließ. Das Schreiben darüber und eine Therapie haben ihr sehr bei der Verarbeitung und Bewältigung ihrer psychischen Krankheit geholfen. Mit ihren Texten möchte sie anderen zeigen, dass es wichtig ist, mentale Gesundheit und Suizid zu enttabuisieren, damit andere nicht ebenfalls jahrelang schweigen.
Das Schweigen
Lange litt mein Vater unter Depressionen und Suizidgedanken, verbrachte viel Zeit in Kliniken und bei Therapien. Sein Tod, als ich 15 Jahre alt war, wurde für mich zu einem Tabu, über das ich nicht sprach, das ich tief in mir vergrub.
Nach Ende des Schuljahres zog meine Mutter mit mir zu ihrer Schwester nach Ägypten. In der neuen Schule, der Millionenstadt Kairo, weit weg von dem Dorf, in dem jeder unsere vermeintliche Schande kannte, konnte ich neu anfangen. Ich musste mich nicht erklären, war nicht gebrandmarkt, das Leben ging weiter. Dass sich Verdrängung früher oder später rächt, erfuhr ich fast drei Jahrzehnte später mit voller Wucht am eigenen Leib.
Wie ich zu reden begann
Es war nicht so, dass ich nie jemandem von meinem Vater erzählte. 2013 hatte mich bereits das Buch „Hinter dem Blau“ von Alexa von Heyden zu einem offeneren Umgang mit meiner Geschichte ermutigt. Aber es zu erwähnen, ist eben doch etwas anderes, als sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Als ich einem Freund, bei dem ich eine Depression vermutete, 2021 in einer E-Mail von meinem Vater erzählte, traf mich seine Antwort wie ein Vorschlaghammer: „Mein Vater hat sich, du wirst es kaum glauben, auch umgebracht.“ Ich brach in Tränen aus, starrte immer wieder ungläubig auf diesen Satz. Wir begannen ein offenes Gespräch, das ich so noch nie mit jemandem geführt hatte. Mit jemandem, der das Gleiche erlebt hatte. Es schien eine Erleichterung zu sein. Endlich zu wissen, dass man mit diesem Schicksal nicht alleine ist. Tagelang las ich unsere Unterhaltung immer und immer wieder, weinte – und was eigentlich gut begonnen hatte, entwickelte sich zu einem gewaltigen Abwärtsstrudel, der mich immer weiter in die Tiefe riss.
Ungeahnte Ängste
Die folgenden Monate entwickelte ich bis dahin ungeahnte Ängste. Angst vor schweren Krankheiten, davor, nicht mehr für meine Kinder da sein zu können, Angst vor dem Tod. Ich achtete immer stärker auf meinen Körper, googelte wie besessen Symptome, lag nächtelang wach und beobachtete meinen Herzschlag. Es fühlte sich an, als schlüge mein Herz völlig aus dem Takt in einem Hohlraum in meiner Brust und ich konnte nichts anderes mehr wahrnehmen. Irgendwann kam die erste Panikattacke. Überzeugt von einem Herzinfarkt, fuhr ich in die Notaufnahme und erfuhr, dass mit mir alles in Ordnung sei. Nur, dass einfach gar nichts mehr in Ordnung war. Mein Leben war aus den Fugen geraten. Immer öfter saß ich weinend bei meiner Hausärztin, die mir dringend eine Therapie empfahl und eine Überweisung ausstellte.
Die Therapie, die mir half
Ich suchte nach einem Therapieplatz, was sich als schwieriges Unterfangen erwies und immer wieder gab ich zunächst entmutigt auf. Der Leidensdruck war zwischendurch immer größer geworden, lähmte mich. Doch irgendwann hatte ich Glück und bekam ein Erstgespräch bei einem Therapeuten. Er war mir sofort sympathisch und es sprudelte förmlich alles aus mir heraus. Die ersten Male verließ ich die Sitzung meist schluchzend und ich fragte mich insgeheim, ob und wie es mir helfen sollte, alles noch einmal zu durchleben. Trotzdem wurde mein Therapeut schnell zu meinem Rettungsanker, der mir Halt und Hoffnung gab, dem ich bedingungslos vertraute. Die Besserung kam schleichend, zunächst fast unbemerkt. Irgendwann fiel mir auf, dass wir immer häufiger auch gemeinsam lachten, die Sitzungen unbeschwerter wurden, die Last abnahm. Mit seiner positiven Bestärkung gelang mir ein riesen Schritt: 28 Jahre nach dem Suizid meines Vaters redete ich mit meiner Mutter. Lange war mir nicht klar gewesen, wie viel Wut auf sie in meinem Inneren verborgen war. Wegen des Schweigens, zu dem sie mich verdammt hatte, weil es in ihrer Wohnung kein Foto meines Vaters gab und vielem mehr. Als sie mir erzählte, dass sie sich die Schuld an allem gegeben hatte und mit niemandem darüber reden konnte, weil sie sich sicher war, dass auch alle anderen ihr die Schuld gaben, konnte ich ihr verzeihen. Ich hatte Mitgefühl und verstand, wie schwierig die Situation für sie gewesen sein muss – mit der (ungerechtfertigten) Schuld zu leben, alles mit sich alleine auszumachen und gleichzeitig noch für ihre beiden Kinder zu sorgen. So gut es ihr eben möglich war.
Offen darüber reden
In den folgenden Monaten sprach ich mit vielen Freundinnen und Freunden über meinen Vater. Es fällt mir jetzt leichter und löst kaum noch unangenehme Gefühle in mir aus. Es tut gut, dass sie meine Geschichte und meine Therapie jetzt als Teil von mir kennen und auch das Schreiben darüber empfinde ich als eine Art Befreiung – es schwelt nicht mehr unbemerkt vor sich hin, ist kein Tabu mehr.
Immer öfter verließ ich die Therapiesitzungen mit einem glücklichen Gefühl, geradezu beschwingt. Wie viel das Sich-Öffnen bewirken kann, hätte ich nicht für möglich gehalten. Natürlich waren da manchmal tief in mir Zweifel, ob das jetzt mein neues, positiveres Leben ist oder nur eine Phase. Darum begleitete mich mein Therapeut noch eine Weile, vergrößerte aber nach und nach die Abstände, in denen wir uns sahen. Es gab mir zusätzliche Kraft, ihn noch an meiner Seite zu wissen – ein Sicherheitsnetz, das mich im Notfall auffangen könnte. Das ich allerdings nicht brauchte. Inzwischen ist meine Therapie beendet und der Abschied fiel mir wirklich schwer. Immerhin waren wir anderthalb Jahre auf einer gemeinsamen Reise.
Ich würde nicht sagen, dass alles wieder wie vor meiner psychischen Erkrankung ist, aber meine letzte Panikattacke liegt schon über ein Jahr zurück und ich google nur noch selten Krankheitssymptome. Ich denke, ich bin insgesamt mutiger und offener im Umgang mit Menschen und Emotionen, aber auch verletzlicher. Das ist in Ordnung. „Warum nicht von Gefühlen übermannt sein und weinen?“ schrieb mir mein Therapeut. Ich solle mir Gefühle erlauben. Sie kommen und gehen, sind mal leichter und mal heftiger. Und das ist wohl das ganze Geheimnis: Hätte ich meine Trauer und meine Wut früher zugelassen, dann wäre ich vielleicht nie an den Punkt gekommen, an dem ich ohne Hilfe nicht mehr konnte.
